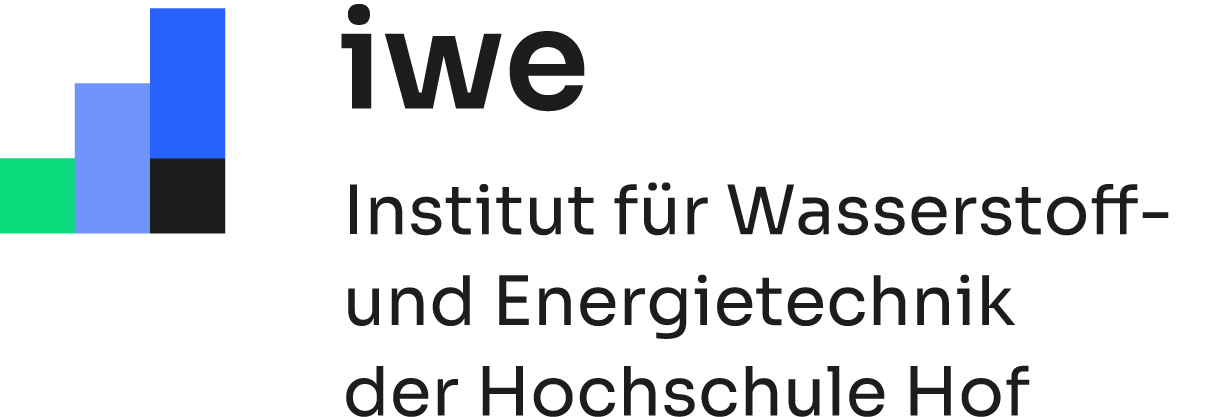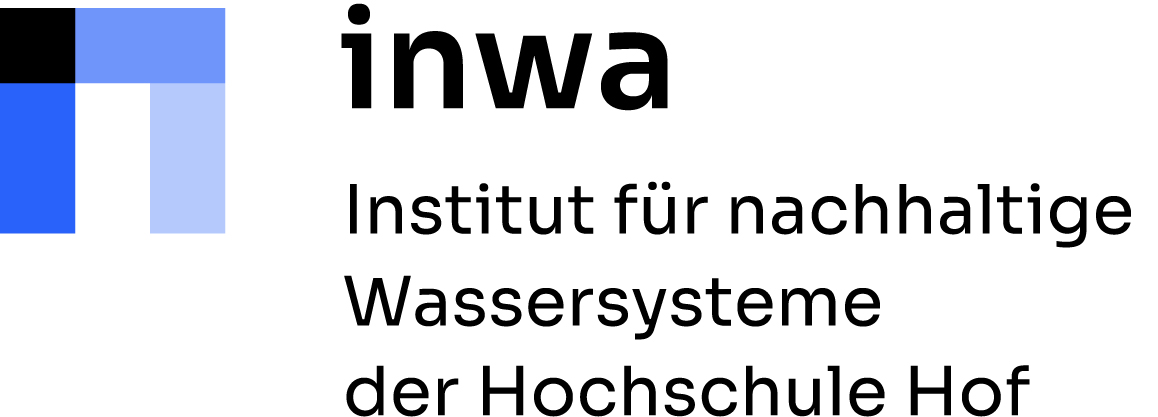Aktuelle Projekte
Das Ziel dieses Forschungsprojektes ist die Erhöhung der Erfolgsbedingungen technischer Entwicklungsvorhaben der Dr. Schneider Unternehmensgruppe durch Einbeziehung kundenbezogener Akzeptanzforschung seitens der Forschungsgruppe ERUX der Hochschule Hof.
Zielsetzungen sind: die Analyse und Evaluation der Klimakontrolle und der entsprechenden Bedienmodi, Analyse und Evaluation von Bedienelementen hinsichtlich des audiovisuellen und haptischen Feedbacks und eine Laborstudie zur Wohlfühlatmosphäre in Fahrzeuginnenräumen.
Glasproduktions-Analytik (GlaDAna)


Das Unternehmen HEINZ-GLAS sowie das Institut für Informationssysteme der Hochschule Hof (iisys) haben am 1. Oktober das Projekt GlaDAna (Glas-Daten-Analyse) zur Analyse von Daten aus der Produktion von Flakons begonnen. Die Daten stammen aus dem Werk am Standort Kleintettau, an dem HEINZ-GLAS eine anspruchsvolle Produktionsumgebung mit hohem Automatisierungsgrad für Glas-Flakons betreibt.
Ziel dieses Projektes ist die systematische Analyse von Daten zur Erhöhung der Produktivität auch durch die Verminderung des Ausschusses sowie der Vermeidung von Problemen, die sich mit Hilfe dieser Daten bereits frühzeitig erkennen lassen.
Die Projektpartner haben sich über das Innovations-Zentrum Region Kronach kennengelernt.
Wissensmanagement für die Industrie 4.0 (IWInxt 2)


Im Rahmen des Projekts IWInxt 2 werden Softwarekomponenten entwickelt und erprobt, die die Wartung von Industrieanlagen im Fokus haben.
Der Erfahrungsschatz von Mitarbeitern spielt bei der Wartung eine wichtige Rolle. Eine relevante Wartungsstrategie im Rahmen des Projektes ist die Corrective Maintenance. Wartungsarbeiten dieser Klasse hängen wesentlich von den Kenntnissen und Fähigkeiten des Experten ab. Beispielsweise bei der Ausfallzeit einer Maschine wirkt sich die Dauer unmittelbar auf die entstehenden Kosten aus. IWInxt 2 erweitert den Einsatz des im vorausgegangenen Projekt erarbeiteten Wissensmanagement-Systems auf weitere wissensintensive Aufgaben in Industriebetrieben über die Wartung hinaus.
Partner ist die Dr. Schneider GmbH.
Fotos: Innovations-Zentrum Region Kronach e.V.
Smart Sponge Region (SPORE)
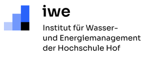

Von den Folgen des Klimawandels sind auch ländliche Regionen betroffen. Das erfordert regionale Anpassungsmaßnahmen. Im Forschungsvorhaben SPORE wird deshalb das Konzept der Smart Sponge Region entwickelt und auf die Region Hof/Hochfranken/Oberfranken angewendet. Mit diesem Konzept soll der Erhalt der ökologischen Funktion, der nachhaltige Umgang mit Ressourcen und die Ausgleichssteuerung zwischen Starkregen und Trockenzeiten (Schwammregion) sichergestellt und die langfristige Sicherung der regionalen wirtschaftlichen Entwicklung ländlicher Regionen unterstützt werden. Das Konzept vereint Elemente der Digitalisierung und der Vernetzung zur intelligenten Steuerung von Wasserhaushaltselementen sowie Infrastrukturmaßnahmen. Insbesondere sollen digitale Lösungen und deren Anwenderfreundlichkeit über optimierte Mensch-Maschine Schnittstellen hervorgehoben werden. Dazu gehören z.B. Konzepte für die Steuerung und Kontrolle von Prozessen mittels digitaler Messnetze von Umweltparametern. Im Projekt wird ein regionales Netzwerk bestehend u.a. aus Firmen, Kommunen und Fachbehörden aufgebaut, um regionalspezifische Lösung zu erarbeiten. Schließlich wird ein Leitfaden zur Umsetzung des Smart Sponge Region Konzepts für andere Regionen erstellt.
Neben der Mensch-Maschine-Schnittstelle fördert auch die Wilo-Stiftung das Projekt. SPORE beginnt am 01. Mai 2022 und endet am 31. Oktober 2023.
Mehr Infos und Kontakt zum Projektteam: https://inwa.hof-university.de/index.php/startseite/projekte/spore/
Sustainability and Optimized Handling for new Interfaces in the Automotive Interior (SOHIAI)
Die Dr. Schneider Unternehmensgruppe GmbH ist ein führender Hersteller von kinematischen Bauteilen für die Automobilindustrie. Hierbei liegt der Fokus auf Dekorelementen sowie Belüftungs-, Ablage- und Tanksystemen. Um den stetig wachsenden Ansprüchen an Haptik und Funktion gerecht zu werden, müssen die Schnittstellen zwischen Kinematik und Bediener – also dem Menschen – sehr genau abgestimmt werden. Im Rahmen des Strategieprojektes „Sustainability and optimized handling for new interfaces in the automotive interieur“ soll zum einen die Schnittstelle zwischen Mensch und der zu bedienenden Maschine, z.B. einem Cupholder oder einem Ausströmersystem verbessert werden, zum anderen soll mit diesem Projekt der vom Verbraucher sowie der Politik immer stärker werdenden Forderung nach nachhaltigen Produkten und der Reduktion von Treibhausgasen Rechnung getragen werden. Hierfür sollen für zukünftige Projekte neuartige und nachhaltige Werkstoffkombinationen zum Einsatz kommen. Hierzu werden bis zu 10 unterschiedliche Materialien aus den Bereichen der Biopolymere und der technischen Recyclate analysiert.
Entwicklung eines vom Nutzerverhalten abhängigen Pufferspeicher- und Lastmanagements am Demonstrationsnahwärmenetz Bioenergie Nordhalben

Ziel des Projektes ist es, zusammen mit der Bioenergie Nordhalben, dem Hersteller von Wärmesystemen ENERPIPE und dem Hackschnitzelkesselhersteller HDG eine Schnittstelle zu entwickeln, wonach die Regelung des Hackschnitzelkessels die aktuelle Wärmeanforderung der Verbraucher erkennt. Dabei kann die Art der Anschlüsse und die Betriebsweisen der Verbraucher sehr verschiedenartig sein. Daraus abgeleitet soll die Leistung der Umwälzpumpe des Wärmenetzes und die Leistung des Hackschnitzelkessels angepasst werden, um Netz- und Speicherverluste im Heizhaus zu verringern. Energie Mitwitz und Communität Christusbruderschaft Selbitz KdöR stellen der Hochschule Hof in diesem Zuge ihre Wärmedaten für Analysen zur Verfügung. Startschuss ist der 1. Januar 2020. In zwei Förderabschnitten soll der Technologie- und Methodentransfer angestrebt werden. Diesem Projekt ist bereits ein erfolgreich abgeschlossenes Vorhaben unter dem Titel „PuLaMa“ vorausgegangen.
The Human Machine Interface in the context of self-driving cars

Aktuell befindet sich die Entwicklung der Industrie am Übergang vom teilautomatisierten zum hochautomatisierten Fahren. Dabei führt der zunehmende Wettbewerb, als erster mit einem voll autonomen Fahrzeug der SAE-Stufe 5 auf den Markt zu kommen dazu, dass sich die Unternehmen mit immer früheren Ankündigungen der Produkteinführung zu überbieten versuchen.
Als Nebeneffekt des intensiven Wettbewerbs der Automobil-OEM und der Zulieferer lässt sich eine Entkoppelung der technologischen Entwicklung von den Kunden beobachten: Die Fahrerassistenzsysteme werden immer mehr auf Autonomie getrimmt, während die Kunden gedanklich für die neuen Systeme noch gar nicht bereit zu sein scheinen. Diese Entwicklung kann anschaulich am Beispiel des automatisierten Park-Lenk-Assistenten verdeutlicht werden: Trotz der Verfügbarkeit dieser Technologie am Markt seit 2011 und des zunehmenden Einbaus dieser automatisierten Park-Lenk-Assistenten in Neufahrzeugen scheint die Nutzungsfrequenz weit unter den Erwartungen der Automobilhersteller sowie ihrer Zulieferunternehmen zu liegen.
In diesem Forschungsprojekt arbeitet die Forschungsgruppe ERUX mit der Valeo Schalter und Sensoren GmbH, einem der weltweit führenden Hersteller von Sensorik-Systemen in der Automobilindustrie, zusammen. In Kooperation mit den Standorten des Unternehmens in Kronach und Bietigheim-Bissingen wird untersucht, wo mögliche Hürden für die Akzeptanz von Fahrerassistenzsystemen (FAS) liegen und welche Maßnahmen geeignet sind, den Diffusionsprozess der neuen Technologien zu fördern. Schließlich sollte die Frage, wie hochautomatisierte Fahrzeuge zu gestalten sind, nicht nur aus technischer oder juristischer Perspektive, sondern in erster Linie aus Sicht der Kunden beantwortet werden, um die Kundenakzeptanz und damit den wirtschaftlichen Erfolg der FAS zukünftig sicherzustellen.